[CENTER]
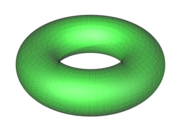
[/CENTER]
Am 24. Oktober 2007 wurde durch Beschluss der Volksrepublik China, EURATOM, der Republik Indien, Japan, der Republik Korea, der russischen Föderation sowie der Vereinigten Staaten von Amerika vom 21. November 2006 die internationale ITER Organisation offiziell gegründet.
Die ITER Organisation mit Sitz in Cadarache (Frankreich) hat zum Ziel, die technische und wissenschaftliche Machbarkeit der Energiegewinnung mit Hilfe der Kernfusion nachzuweisen. ITER wird das erste Fusions-Experiment in der Geschichte, das eine Leistung aufweisen kann, die in der Größenordnung eines Donaukraftwerkes liegt. Es dient der Untersuchung und Verbesserung sämtlicher für die Kernfusion als zukünftige Energiequelle benötigter Schlüsseltechnologien sowie der Validierung industrieller Produktionsmethoden für die in zukünftigen Kernfusionskraftwerken benötigten Großkomponenten, die höchsten qualitativen Anforderungen genügen müssen.
Nach Angaben des offiziellen Kandidaten für die ITER-Leitung, Herrn Kaname Ikeda, wurde mit dem endgültigen Zustandekommen des ITER-Projektes ein historisch wichtiger Meilenstein erreicht: "Mit ITER wurde eine neue internationale Organisation gebildet. Die Nationen dieser Welt haben mit der ITER-Gründung gezeigt, dass sie den Bedarf an neuen Energiequellen erkannt und verantwortungsbewusst und vorausschauend darauf reagiert haben. Mit dem ITER-Projekt wurde von Seiten der ITER-Mitglieder ein komplett neues Modell der internationalen Zusammenarbeit geschaffen."
Hintergrund zum ITER-Experiment
Kernfusion - der Prozess, durch welchen zwei leichte Atomkerne miteinander zu einem schwereren Kern verschmelzen - ist die Energiequelle unserer Sonne und der Sterne. Auf der Erde hat sie das Potential, einen wesentlichen Anteil an zukünftigen nachhaltigen Energiequellen zu bilden. Kernfusion wird sichere und umweltfreundliche Energie liefern. Dabei kommt schwerer Wasserstoff, ein im Überfluss vorhandener Rohstoff zur Anwendung. Es entstehen im Fusionsprozess keinerlei Treibhausgase.
Wissenschaftler und Techniker arbeiten weltweit im Bereich der Fusionsforschung mit dem Ziel, so schnell wie möglich ein Strom produzierendes Fusionskraftwerk zu entwickeln. Ein wichtiger Schritt dazu wurde am 21.11.2006 unternommen, als sich die Repräsentanten Europas, Japans, Chinas, Indiens, der Republik Korea, der russischen Föderation sowie der USA zusammengefunden haben, um eines der herausforderndsten wissenschaftlichen Experimente der jüngeren Zeit ins Leben zu rufen: das ITER-Projekt.
Die Grundidee für das ITER-Experiment wurde in Genf bei einem Treffen der Supermächte im November 1985 geschaffen. Präsident Gorbatschow schlug nach eingehenden Diskussionen mit dem französischen Präsidenten Mitterand dem amerikanischen Präsidenten Reagan vor, ein internationales Projekt zur Weiterentwicklung der Fusionstechnologie zu friedlichen Zwecken zu gründen. Infolgedessen wurden erste Vorplanungen für das ITER-Projekt unter Zusammenarbeit der UdSSR, der USA, der EU und Japans unter Führung der Internationalen Atombehörde IAEA aufgenommen.
Das Ziel des ITER-Projektes ist, "die wissenschaftliche und technologische Machbarkeit der Energiegewinnung durch Kernfusion zu friedlichen Zwecken nachzuweisen". Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ITER darauf ausgelegt, im Vollbetrieb bis zu 500 MW an Fusionsleistung zu generieren. Dies ist der zehnfache Wert jener Leistung, die zur Aufrechterhaltung des Fusions-Brennvorganges dem Experiment zugeführt werden muss. ITER ist ein wissenschaftliches Experiment, welches flexibel an wechselnde Erfordernisse im laufenden Betrieb angepasst werden kann. Es dient der Untersuchung und Verbesserung sämtlicher für die Kernfusion als zukünftige Energiequelle benötigter Schlüsseltechnologien sowie der Validierung industrieller Produktionsmethoden für die in zukünftigen Kernfusionskraftwerken benötigten Bestandteile.
Die ITER Organisation
Das ITER-Projekt wird von einer internationalen Organisation geführt, der "ITER Organization" mit Sitz in Cadarache im Süden Frankreichs. Es gilt das Prinzip der Subsidiarität. 90 Prozent der Komponenten des ITER-Projektes werden in Produktionsstätten der ITER-Mitgliedsländer gefertigt. Die Mehrzahl der Konstruktionsarbeiten wird von den ITER-Assoziationsbehörden der Mitgliedsländer organisiert, Auftragsarbeiten an die heimische Industrie von diesen vergeben. Die ITER-Organisation selbst ist nur für die Entwicklung der verbleibenden zehn Prozent der ITER-Komponenten direkt verantwortlich.
Das ITER-Design
ITER basiert auf dem "Tokamak"-Konzept; dabei wird der Fusionsbrennstoff in einem schwimmreifen-förmigen Gefäß gehalten. Der Brennstoff - eine Mischung aus Deuterium und Tritium, zwei Wasserstoff-Isotopen - wird auf eine Temperatur von weit über 100 Millionen Grad aufgeheizt, wodurch sich ein heißes "Plasma" bildet. Das Plasma wird durch ein starkes Magnetfeld von der Gefäßwand ferngehalten, welches von supraleitenden Spulen, die die Gefäßkammer umgeben, sowie durch einen elektrisch induzierten Strom im Inneren des Plasmas gebildet wird. Das ITER-Experiment wird zum ersten Mal den gemeinsamen Einsatz sämtlicher für die Kernfusion benötigter Technologien sowie die Optimierung der plasmaphysikalischen Prozesse in Kraftwerksdimensionen für eine möglichst effiziente Energieproduktion ermöglichen.
In den 80er-Jahren wurden neben zahlreichen weltweit verstreuten kleineren Experimentieranlagen mehrere größere Tokamakanlagen gebaut: JET in Europa, JT-60 in Japan und TFTR in den Vereinigten Staaten. Neuere Geräte befinden sich Korea (KSTAR), China (EAST) und Indien (SST-1). Gemeinsam wurde und wird durch die Forschung an diesen Kernfusionsanlagen eine solide technische und wissenschaftliche Grundlage für die Konzeption, Konstruktion und Operation des ITER-Experimentes geschaffen.
Um die Ziele, die mit dem ITER-Projekt formuliert wurden, erreichen zu können, wurde das ITER-Experiment etwa doppelt so groß wie die größte bereits existierende Tokamakanlage, der "Joint Europen Torus" (JET), ausgelegt; das Volumen wird sich im Vergleich dazu verzehnfachen. Dadurch wird die zu erwartende Fusionsleistung um ein Vielfaches größer sein als sämtliche bisher erzielten Rekordwerte. Verglichen mit gegenwärtigen Konzepten für ein zukünftiges vollwertiges Fusionskraftwerk wird ITER bereits mit den meisten der dazu benötigten Technologien ausgestattet sein und 0.5 Gigawatt an thermischer Leistung produzieren.
Kosten und Zeitplan
Die Kosten für das ITER-Projekt werden von den sieben Mitgliedern gemeinsam getragen. Die Konstruktionskosten belaufen sich auf etwa fünf Milliarden Euro, verteilt auf über zehn Jahre. Ein ähnlicher Betrag ist für die zwanzigjährige Betriebsphase und den anschließenden Abbau der Anlage vorgesehen. Europa, welches das Experiment beherbergt, wird die Hälfte der Konstruktionskosten beisteuern, die anderen Mitglieder je bis zu 10 Prozent.
Der Baubeginn der ITER-Anlage ist für 2009 veranschlagt, das erste Plasma wird voraussichtlich im Jahre 2016 erzeugt werden können. Im Anschluss daran wird ITER für etwa 20 Jahre in Betrieb sein und schließlich in einer Zeit von ca. fünf Jahren deaktiviert und abgebaut.
Sicherheit
Der Fusionsprozess bildet keine Kettenreaktion, daher kann der Reaktionsprozess auch nicht außer Kontrolle geraten. Die Kernfusion kann innerhalb weniger Sekunden durch einfache Unterbrechung der Brennstoffzufuhr geräteschonend heruntergefahren werden.
Eine der beiden Brennstoffkomponenten, das zweiwertige Wasserstoff-Isotop Deuterium, ist eine völlig harmlose Substanz, die sich aus gewöhnlichem Wasser extrahieren lässt. Die andere Komponente, das dreiwertige Wasserstoff-Isotop Tritium, ist eine leicht radioaktive Substanz (niedrigenergetischer Betastrahler). In zukünftigen Fusionskraftwerken wird Tritium im Kraftwerksinneren mithilfe des Leichtmetalls Lithium hergestellt. Die einzige radioaktive Komponente des Brennmaterials wird dadurch innerhalb der Maschine erzeugt und verbraucht und somit in einem geschlossenen Kreislauf geführt.
Im ITER-Experiment wird die Tritiumherstellung bereits angewandt, jedoch noch nicht in ausreichendem Ausmaß. Es wird daher auch extern produziertes Tritium, welches zB als Nebenprodukt in der Kernspaltung anfällt, verwendet werden. Zahlreiche Schutzbarrieren in der ITER-Anlage sowie spezielle Transportmethoden werden sicherstellen, dass der Umgang mit Tritium sicher erfolgt und sämtlichen strahlenschutztechnischen Normvorschriften entspricht.
Der Weg zur Fusionsenergie
Es ist das Ziel der Fusionsforschung, einen Kraftwerksprototyp zu entwickeln, welcher den sicheren, umweltfreundlichen und wirtschaftlich effizienten Betrieb demonstrieren soll. ITER (auf Latein "der Weg") ist in diesem Sinne nicht als eigenständiges Projekt anzusehen. Es ist vielmehr eine Brücke hin zu einem ersten vollwertigen Fusionskraftwerk, "DEMO" genannt, welches elektrischen Strom in großtechnischem Ausmaß produzieren wird (mehrere Gigawatt Stromleistung).
Zur Vorbereitungs des DEMO-Kraftwerkes wird parallel zum ITER-Projekt ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm im Bereich der Fusionsphysik und -technologie durchgeführt. Es ist beabsichtigt, dass DEMO in etwa 30-35 Jahren in Betrieb gehen wird. Es wird die Entwicklung der Kernfusion in die industrielle Phase überführen und den Weg für kommerzielle Anwendungen ebnen.
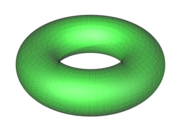 [/CENTER]
[/CENTER]